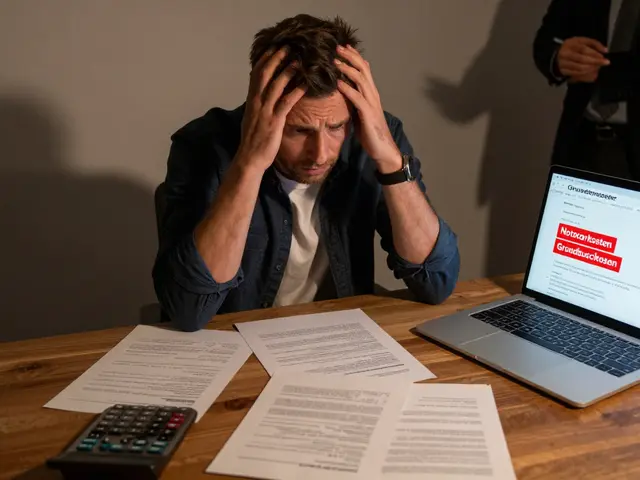Stellen Sie sich vor, Sie rollen mit dem Rollstuhl von der Wohnung auf die Terrasse - ohne an einer Schwelle hängenzubleiben, ohne sich an einer Kante zu stoßen, ohne dass Ihr Kind stolpert oder Ihre Oma Angst hat, den Fuß zu heben. Das ist kein Traum. Das ist schwellenloser Übergang - und er ist heute technisch machbar, gesetzlich gefordert und immer häufiger die Norm, nicht die Ausnahme.
Was bedeutet eigentlich „schwellenlos“?
Viele denken, eine niedrige Schwelle von einem Zentimeter oder zwei ist „barrierefrei“. Das ist falsch. Laut DIN 18040-2 (2023) ist nur eine Schwelle von exakt null Millimetern wirklich barrierefrei. Das heißt: Der Boden von innen und außen liegt auf derselben Ebene. Kein Höhenunterschied. Kein Risiko. Kein Stolpern. Kein Hindernis für Rollstühle, Kinderwagen, Gehhilfen oder einfach nur müde Füße. Die alte Ausnahme, die bis 2013 noch als akzeptabel galt - „Schwellen bis zu 2 cm, wenn technisch unabdingbar“ - ist heute obsolet. Der Arbeitsausschuss für barrierefreies Bauen im Deutschen Institut für Normung hat das klar gestellt: Nur null Millimeter zählt. Und das gilt nicht nur für Wohnungs-Eingangstüren, sondern auch für Türen zu Balkon und Terrasse. Denn wer sagt, dass der Balkon kein Wohnraum ist? Wer sagt, dass man dort nicht sitzen, essen, lesen oder meditieren will?Warum ist das so wichtig?
Denken Sie an Ihre Großeltern. An Ihre Kinder. An sich selbst in zehn Jahren. Eine Schwelle ist kein kleiner Ärgernis - sie ist ein Risiko. 41 Prozent der Nutzer, die schwellenlose Übergänge haben, berichten von Problemen mit Wasser, wenn die Entwässerung nicht stimmt. Aber 68 Prozent sind insgesamt zufrieden - vor allem, weil sie endlich frei bewegen können, ohne Angst vor einem Sturz. Für Rollstuhlfahrer ist ein schwellenloser Übergang kein Luxus, sondern eine Frage der Selbstständigkeit. Für Familien ist es Sicherheit. Für ältere Menschen ist es der letzte Halt vor Abhängigkeit. Und für alle, die Wert auf moderne Architektur legen, ist es einfach schöner. Keine sichtbare Kante. Kein „Innen“ und „Außen“ als getrennte Welten. Nur ein fließender Raum, der sich vom Wohnzimmer bis zur Terrasse erstreckt.Wie funktioniert das technisch?
Ein schwellenloser Übergang klingt einfach - aber er ist eine Meisterleistung der Bautechnik. Die größte Herausforderung? Die Abdichtung. Wenn es keine Schwelle gibt, kann Wasser nicht einfach ablaufen. Es muss gezielt abgeleitet werden - sonst läuft es ins Haus. Die Lösung: Magnet-Doppeldichtungen. ALUMAT hat vor über 20 Jahren eine Technologie entwickelt, die heute Standard ist. Ein Dauermagnet an der Türunterseite zieht sich beim Schließen an zwei weitere Magnete in der Bodenschiene - die Tür wird dicht, wie eine Kühlschranktür. Beim Öffnen sinken die Magnete ab. Keine Schwelle. Kein Widerstand. Und trotzdem: Schlagregendichtheit der Klasse 9A nach DIN EN 12208. Das bedeutet: Selbst bei Starkregen mit 90 Litern pro Quadratmeter und Stunde bleibt das Haus trocken. Das Wasser läuft über eine integrierte Rinne in eine Sammelkammer und wird dann über Drainagen nach außen geleitet. Wichtig: Die Fläche muss ein Gefälle von mindestens 2 % haben - also zwei Zentimeter Höhenunterschied pro Meter. Sonst sammelt sich Wasser. Und das führt zu Schäden.
Was kostet das?
Ja, es ist teurer. Ein schwellenloser Übergang kostet 30 bis 40 Prozent mehr als eine herkömmliche Tür mit Schwelle. Bei einem Neubau sind das zwischen 1.500 und 2.500 Euro Zusatzkosten. Klingt viel? Vergleichen Sie es mit den Kosten eines Sturzes - medizinischer Behandlung, Umbau, Pflege. Oder mit dem Wert, den Sie Ihrer Familie geben: Freiheit, Sicherheit, Würde. Und hier ist der Trick: Wer früh plant, spart. Wenn die Abdichtung, die Entwässerung und die Tür in einer Hand geplant werden - vom Architekten über den Dachdecker bis zum Tischler - dann entstehen keine teuren Nachbesserungen. Die Bayerische Architektenkammer sagt: Systemlösungen eines Herstellers sind zwar 15 bis 20 Prozent teurer, aber sie sparen Zeit, reduzieren Fehler und vermeiden Streit zwischen den Gewerken.Was geht schief - und wie vermeiden Sie es?
Die größte Ursache für Probleme? Nicht die Technik. Die Kommunikation. Ein Architekt plant die Tür, der Dachdecker macht die Abdichtung, der Installateur legt die Drainage - und keiner spricht mit dem anderen. Ergebnis: Die Entwässerung ist zu weit von der Tür entfernt. Das Gefälle ist zu flach. Die Dichtung passt nicht zum Bodenbelag. Die TU Dresden hat 2023 eine Studie gemacht: Bei nicht spezialisierten Handwerkern liegt die Fehlerquote bei 35 Prozent. Das heißt: Jede dritte schwellenlose Tür läuft Wasser ein - oder lässt sich nicht richtig schließen. Wie vermeiden Sie das?- Planen Sie mindestens 4-6 Wochen vor der Ausführung.
- Wählen Sie einen Hersteller, der das gesamte System liefert - Tür, Dichtung, Entwässerung, Bodenplatte.
- Verlangen Sie eine schriftliche Dokumentation der Abdichtungs- und Entwässerungslösung.
- Stellen Sie sicher, dass der Bodenbelag (Fliesen, Holz, Beton) auf der gleichen Ebene endet - kein Übergangsbereich mit Unterbrechung.
- Verlangen Sie eine Prüfung durch einen Sachverständigen vor der Fertigstellung.
Was ist mit Nachrüstung?
Wenn Sie schon wohnen und jetzt nachrüsten wollen - ist das möglich? Ja. Aber schwieriger. Die Bodenplatte muss angehoben oder abgesenkt werden. Die Abdichtung muss neu verlegt werden. Die Drainage muss neu geplant werden. Das ist oft teurer als im Neubau. Und manchmal gar nicht machbar - besonders bei Balkonen mit Dachuntersicht oder bei Terrassen mit Hanglage. In solchen Fällen gibt es eine gute Alternative: barrierearme Übergänge. Das heißt: Eine Schwelle von 2 bis 15 Millimetern. Nicht vollständig schwellenlos - aber so niedrig, dass Rollstühle und Kinderwagen problemlos darüber rollen. Das ist eine sinnvolle Kompromisslösung, wenn die technischen Voraussetzungen für eine Nullschwelle nicht gegeben sind.
Die Zukunft: Intelligent, nachhaltig, normgerecht
Die DIN 18040 wird 2025 aktualisiert - und wird die 2-cm-Ausnahme weiter einschränken. Die Flachdachrichtlinien werden 2025 überarbeitet, um schwellenlose Übergänge klarer zu regeln. Der Markt wächst: 2020 waren nur 7 Prozent der Neubauten schwellenlos. 2023 waren es schon 12 Prozent. Bis 2027 soll es 20 Prozent sein. Warum? Weil die Bevölkerung älter wird. 22,3 Prozent der Deutschen sind über 65. Und weil die Wetterlage sich ändert. Starkregen wie in Köln 2021 zeigen: Wer keine dauerhafte, rückstaufreie Lösung hat, riskiert massive Schäden. Innovative Hersteller arbeiten bereits an der nächsten Generation: Selbstreinigende Magnetdichtungen, die Schmutz und Blätter abweisen. Intelligente Entwässerungssysteme mit Sensoren, die bei Starkregen automatisch die Kapazität erhöhen. Hybride Lösungen, die je nach Lage - Hang, Dachterrasse, Nordseite - zwischen 0 mm und 15 mm variieren.Was tun, wenn Sie planen?
Wenn Sie gerade bauen oder sanieren, fragen Sie jetzt:- Wird die Tür zu Balkon oder Terrasse schwellenlos ausgeführt?
- Welches System wird verwendet - und ist es nach DIN 18040-2 zertifiziert?
- Wer plant die Entwässerung - und hat er Erfahrung mit schwellenlosen Übergängen?
- Wird eine Prüfung durch einen Sachverständigen durchgeführt?
Was ist mit Wartung?
Ein schwellenloser Übergang ist kein „installieren und vergessen“-Produkt. Er braucht Pflege. Vierteljährlich sollten Sie:- Die Magnetdichtung prüfen - ist sie sauber? Gibt es Risse oder Verschmutzungen?
- Die Entwässerungsrinnen reinigen - Blätter, Sand, Moos blockieren die Ableitung.
- Das Gefälle prüfen - hat sich der Boden verformt?
Ist eine Schwelle von 2 cm noch erlaubt?
Nein. Laut DIN 18040-2 (2023) ist nur eine Schwelle von null Millimetern als barrierefrei anerkannt. Die alte Ausnahme von bis zu 2 cm gilt nicht mehr - auch nicht als „technisch unabdingbar“. Nur ein Sachverständiger vor Ort kann Ausnahmen prüfen, und das ist heute extrem selten.
Kann ich eine schwellenlose Tür nachträglich einbauen?
Ja, aber es ist aufwendig. Die Bodenplatte muss angepasst werden, die Abdichtung neu verlegt und die Entwässerung neu geplant. Die Kosten liegen oft höher als bei einem Neubau. In einigen Fällen - etwa bei Hanglagen oder beschränktem Platz - ist es technisch nicht machbar. Dann ist eine barrierearme Lösung (2-15 mm) die bessere Alternative.
Warum läuft bei manchen schwellenlosen Türen Wasser ein?
Das liegt fast immer an der Entwässerung: entweder ist das Gefälle zu gering (unter 2 %), die Rinne ist verstopft, oder die Abdichtung ist nicht richtig angeschlossen. Auch falsch installierte Magnetdichtungen können undichte Stellen haben. Professionelle Systeme mit vollständiger Planung vermeiden das - bei Eigenbau oder ungeprüften Handwerkern ist das Risiko hoch.
Was ist der Unterschied zwischen barrierefrei und barrierearm?
Barrierefrei bedeutet: keine Schwelle - null Millimeter Höhenunterschied. Barrierearm bedeutet: eine sehr niedrige Schwelle von 2 bis 15 Millimetern. Beide sind nutzbar für Rollstühle und Kinderwagen. Aber nur die Nullschwelle erfüllt die gesetzliche Definition von Barrierefreiheit nach DIN 18040-2.
Wie viel kostet eine schwellenlose Tür im Neubau?
Im Neubau liegen die zusätzlichen Kosten für eine schwellenlose Tür mit vollständigem System (Tür, Dichtung, Entwässerung, Abdichtung) zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Das ist 30-40 % mehr als eine herkömmliche Tür mit Schwelle. Die Investition lohnt sich in Sicherheit, Lebensqualität und Wertsteigerung der Immobilie.
Gibt es Förderungen für schwellenlose Übergänge?
Ja. Bei Sanierungen in barrierefreiem Wohnraum können Fördermittel über die KfW (z. B. KfW-Programm 159) oder die Pflegekasse beantragt werden, wenn ein Bewohner pflegebedürftig ist. Auch bei Neubauten für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung gibt es oft kommunale Zuschüsse. Fragen Sie bei Ihrer Kommune oder einem Beratungszentrum für barrierefreies Bauen nach.